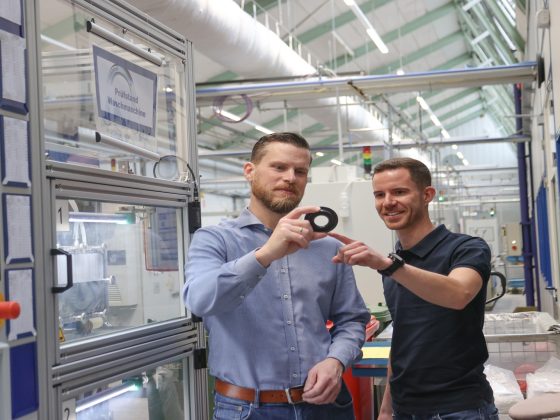Carl Johann Freudenberg – mit ihm beginnt die Erfolgsgeschichte des Technologiekonzerns Freudenberg. Am 9. Februar 1849 gründet er mit einem Partner eine kleine Lederfabrik in Weinheim. Es folgt ein einzigartiger Aufstieg zu einem globalen Unternehmen, der bestens dokumentiert ist, unter anderem in einem modernen Archiv. Doch was verraten uns die historischen Dokumente über die Persönlichkeit des Gründers, über den Menschen Carl Johann? Wie prägen sein Denken und Handeln noch heute die Unternehmenswerte von Freudenberg?
Unternehmensarchivarin Julia Schneider sagt: „Stellen Sie sich einen Start-up-Gründer vor, der gerade zum dritten Mal Vater geworden ist und sich mitten in einem Bürgerkrieg viel Geld bei seinem Schwiegervater leiht, um einen kleinen insolventen Industriebetrieb zu kaufen!“ Diese zugegeben vereinfachte Annäherung an die Person Carl Johann zeigt: Selbstbewusstsein hat ihm vermutlich nicht gefehlt. Er hatte das Glück, die richtigen Zutaten miteinander verbinden zu können, um vom Lehrling schrittweise zum Mit- und später zum Alleineigentümer seines Unternehmens zu werden. Was waren die Zutaten? Was hat den 30-jährigen Familienvater in einer Phase voller Ungewissheiten an den Erfolg glauben lassen? „Dazu gehören die passenden Charaktereigenschaften, aber auch die richtigen Begleiter, beruflich und privat“, sagt Schneider.

Das Kind
Carl Johann ist erst neun Jahre alt, als er seinen Vater Georg Wilhelm verliert. Dieser betreibt zunächst das Gasthaus „Zum Löwen“ in Hachenburg, gelegen zwischen Köln und Frankfurt. Doch in der frühindustriellen Armutskrise läuft es schlecht. Anfang 1829 muss das Gasthaus geschlossen werden und der Wirt einen radikalen Berufswechsel vollziehen. Ihm wird die Zollerhebungsstelle in Weilburg an der Lahn übertragen, wo er wenig später am 9. März 1829 stirbt. Als einziger bei ihm: sein Sohn Carl Johann, den er aus Hachenburg mitgenommen hat. Die Familie trauert und kämpft um die finanzielle Existenz. Carl Johanns Mutter zieht mit ihm und fünf Geschwistern nach Neuwied, wo Verwandte das Überleben sichern. Mit 14 Jahren muss Carl Johann auf eigenen Beinen stehen und beginnt eine Lehre in der Lederhandlung seines Onkels im 200 Kilometer entfernten Mannheim – für die damalige Zeit eine große Reisedistanz. „Die Not der Familie hat sicher etwas in Carl Johann ausgelöst – bestimmt auch den Drang, mehr aus sich zu machen“, sagt Schneider. „Das leiten wir aus der folgenden Zeit ab, in der er mit Ehrgeiz, Fleiß und Sparsamkeit zu einer Art Selfmade-Man aufsteigt.“
Der Aufsteiger
Carl Johann ist allein auf sich gestellt. Doch er findet schnell zu sich und seinen Stärken. Er lebt als Lehrling seines Onkels Johan Baptist Sammet und dessen Teilhabers Heinrich Christian Heintze in Mannheim – verglichen mit seinem Heimatort eine pulsierende Großstadt. „In dieser Zeit merkt er, welche positiven Auswirkungen sein eigenes Handeln und seine Fähigkeiten auf sein Leben haben. Er gewinnt dadurch Selbstvertrauen, das ihm hilft, sein Ziel weiter zu verfolgen, etwas aus sich zu machen“, sagt die Archivarin. Sein Fleiß und Ehrgeiz treiben ihn dabei an. Der junge Mann bedient nicht nur die Kunden hinter der Theke des Handelshauses und liefert Waren aus, sondern er betreibt mit seinem Verdienst aus der Lederhandlung noch einen Zigarrenhandel. Er, der keine weiterführende Schule besuchte, lernt Französisch und Englisch, geht ins Nationaltheater Mannheim, bewegt sich zunehmend sicher in angesehenen und internationalen Kreisen und beweist weiter sein Können in der Firma des Onkels. 1844 erwirbt er 20 Prozent der Anteile als stiller Teilhaber.
Der Ehemann
Im selben Jahr heiratet Carl Johann Sophie Martenstein, die er ein Jahr zuvor im Frühling bei einem Singkreis, einer sogenannten Liedertafel, kennengelernt hat. Martenstein stammt aus einem wohlhabenden Wormser Elternhaus. Der Vater ist Gewürzhändler, ein angesehener Geschäftsmann. Er gibt sein Einverständnis, dem sicher nicht nur die Prüfung von Herz und Charakter oder gar Aussehen vorausging. Es geht um wirtschaftliche Fakten, sowohl zur persönlichen Finanzlage als auch zum beruflichen Erfolg. In ihren Lebenserinnerungen schreibt Sophie: „Die Überzeugung, einen braven tüchtigen Schwiegersohn zu bekommen, der sich ja 5.000 Gulden [umgerechnet rund 100.000 Euro] verdient hatte, bewogen meinen Vater, ihm seine einzige Tochter anzuvertrauen.“ In den folgenden Jahren kommen zunächst zwei Töchter zur Welt: Elise und Luise, die allerdings früh stirbt. Als der Sohn Friedrich Carl 1848 in Mannheim auf die Welt kommt, tobt bereits die Badische Revolution.

Der Zeitgenosse
Was ist da los vor Carl Johanns Haustür in Mannheim? Es geht um nichts weniger als Pressefreiheit, Geschworenengerichte und einen deutschen Nationalstaat mit einem frei gewählten Parlament. Bis dato ist das Land ein Flickenteppich aus eigenständigen Territorien, darunter das Großherzogtum Baden mit der Stadt Mannheim. Die Revolutionäre teilen sich in zwei Lager: das liberal-
konstitutionelle und das radikaldemokratische. In Mannheim herrscht Aufruhr, ein totaler Umbruch wird verlangt, Volksversammlungen mit Tausenden Teilnehmenden finden statt. Unzählige weitere folgen im ganzen Land. Es gibt Gefechte. „Geschäftsleute, die sich in der Regel stabile politische Verhältnisse wünschen, blicken sorgenvoll auf die Ereignisse. Das gilt auch für unseren Gründer“, sagt die Unternehmensarchivarin von Freudenberg.
Der Unternehmer
Das Land erlebt politische Stürme, in denen auch das Bankhaus zusammenbricht, über das die Lederhandlung mit Hilfe von Wechseln finanziert wird. Die Firma gerät in Zahlungsschwierigkeiten und muss 1848 aufgelöst werden. „Freudenberg hat das Glück, die Krise als Chance für sich nutzen zu können, weil er nun eine starke Familie im Rücken hat, die ihm auch finanzielle Anschubhilfe geben kann“, so Schneider. Sein Schwiegervater, der viel von Carl Johann hält, stellt seiner Tochter Sophie das nötige Kapital zur Verfügung, damit sie ihren Mann bei seinem Vorhaben – er möchte einen Teil der Firma übernehmen – unterstützen kann. Für die damalige Zeit ein progressives Vorgehen, die Tochter so ins Geschäftliche zu integrieren.
Der im Revolutionsjahr geborene Sohn des Firmengründers, Friedrich Carl, schreibt 90 Jahre später in seinen Erinnerungen: „Da die Liquidation die Trennung der beiden Firmeninhaber notwendig machte, konnte Vater zwischen den beiden Teilhabern wählen. Seine Wahl fiel auf Herrn Heintze. So entstand die Firma Heintze & Freudenberg in Weinheim, welche 1849 die kleine Kalbleder-Gerberei übernahm.“
Warum kauft er sich in die Lederfabrik mit Heintze und nicht in den Lederhandel mit dem Onkel ein? Für einen Unternehmer ergeben sich aus der Lederfabrik viel größere Gestaltungsmöglichkeiten und Wachstumschancen als mit einer „einfachen“ Lederhandlung. „Hier zeigt sich der unternehmerische Weitblick von Carl Johann“, sagt Unternehmensarchivarin Schneider. Und noch etwas: „Die Überzeugung, dass er es in diesen unruhigen Zeiten schaffen kann, fußt sicher darauf, dass er sich als Jugendlicher schon einmal aus einer finanziellen Krise befreit hat und dann mit seinen Tugenden erfolgreich wurde. Es wiederholt sich auf eine gewisse Weise etwas, das er bereits einmal meistern konnte. Und diesmal ist er fest entschlossen, seine Erfahrung und Stärken zu seinem Vorteil zu nutzen.“ So stellen sich inmitten der Revolution die Weichen für ein Weltunternehmen. Am 9. Februar 1849, einem Freitag, gründen die Partner mit dem Eintrag ins Handelsregister offiziell die Firma Heintze & Freudenberg. Wenige Monate später ist auch die Revolution niedergeschlagen.
Der Firmenlenker
Innerhalb der nächsten drei Jahre vervierfacht sich der Umsatz, die Anzahl der Mitarbeitenden steigt von 50 auf 170. „Dafür sind drei Aspekte wichtig“, sagt Schneider. Zunächst sei da die Qualität. „Allein in Deutschland existieren zu dieser Zeit rund 10.000 lederproduzierende Betriebe. Freudenberg weiß, er und Heintze können sich nur über Qualität abheben.“ Zum Zweiten ist ihm auch klar, dass er das Geschäft schnell internationalisieren muss, um Felle zu kaufen und Leder zu verkaufen. Nach dem Motto „Go big or go down“ bauen die beiden Beziehungen in die USA und die Schweiz, nach Großbritannien, Frankreich und in die Türkei (damals noch das Osmanische Reich) auf. Zu guter Letzt erkennt Freudenberg früh die Bedeutung von Innovationen, indem er einen Trend aus Frankreich aufgreift und Lackleder produzieren lässt. Damit muss er sich gegen seinen Partner Heintze durchsetzen. „Wer Lackleder macht, fährt in der Kutsche, wer normales Leder macht, geht zu Fuß“, sagt er selbst dazu und beweist erneut Weitsicht. Denn auf der Weltausstellung 1851 in London wird das Produkt aus Weinheim ausgezeichnet und sichert über viele Jahre den frühen Erfolg der Firma.
Der Mentor
Nachdem das Unternehmen 1874 in seinen alleinigen Besitz gelangt und er die Familie Heintze – erneut durch finanzielle Hilfestellung durch die Familie seiner Frau – ausbezahlt hat, kann Carl Johann seine fürsorgliche Seite als Unternehmer zeigen, der vermutlich sein ausschließlich wirtschaftlich denkender Partner zuvor im Weg stand. Im selben Jahr gründet er einen Krankenversicherungsverein für seine Mitarbeitende, aus dem sich später die Betriebskrankenkasse Freudenberg entwickelte. Es folgt ein allgemeiner Unterstützungsfonds für in Not geratene Mitarbeitende und deren Familien. „Man erkennt die Verbindung zu seinen frühen Kindheitserlebnissen“, sagt Schneider.
Zur Unterstützung holt Freudenberg seine Söhne Friedrich Carl und Hermann Ernst ins Unternehmen und macht es damit zu einem Familienbetrieb. 1887 beteiligt er sie zu je einem Drittel als Teilhaber. Zu diesem Zeitpunkt zählt das Unternehmen bereits mehr als 500 Mitarbeitende. Aus Anlass des Generationswechsels und vor dem Hintergrund der inzwischen erreichten Größe des Unternehmens schreibt Carl Johann im Jahr 1887 nun auch seine Geschäftsprinzipien mit eigener Hand nieder. Bescheidenheit, Ehrlichkeit, ein solides finanzielles Fundament und die Fähigkeit, sich den jeweiligen Veränderungen anzupassen, sind für ihn die wichtigsten Grundsätze für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Auch das Motiv des Vertrauens – nicht nur auf sich selbst, sondern auch in seine Familie, Partner, Mitarbeitende – spielt eine große Rolle. „Lieber hundertmal vertrauen auf die Gefahr hin, dass man auch einmal reinfällt, das ist besser, als einmal zu Unrecht misstrauen.“
Zusammengefasst heißt das: Von Schicksalsschlägen geprägt, hat sich Carl Johann Freudenberg durch Fleiß, Sparsamkeit, Strebsamkeit, Selbstvertrauen und Prinzipientreue stets „bemüht, aus jeder Lage das Beste zu machen“ (Zitat aus den Geschäftsprinzipien), um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken. Gepaart mit unternehmerischer Weitsicht, der damit verbundenen Offenheit für Wandel und Innovationen und der von ihm gelebten Vertrauenskultur entwickelt er sich zu einem erfolgreichen Unternehmer, dessen Erbe die Unternehmenskultur bis heute prägt.
Die damals von ihm formulierten Prinzipien bilden bis heute die Basis der global gültigen Geschäftsgrundsätze der Freudenberg-Gruppe.